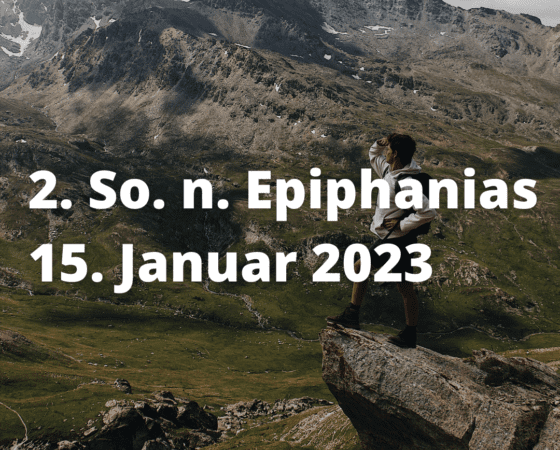Von der Kraft des Gebets | 2. So. n. Epiphanias | 15.01.23 | Exodus 33,12-23 | Bernd Giehl |
Vor ein paar Wochen war ich eingeladen zu einem großen Fest. Es gab einen strengen Dresscode. Ich musste mir extra einen Cut besorgen. Ich selbst besitze keinen, deshalb musste ich mir eigens einen beim Schneider meines Vertrauens anschaffen. Er war nicht gerade billig, und meine liebe Frau fragte tatsächlich, ob wir uns das überhaupt leisten könnten, wo doch die neue Wohnung in Mainz so teuer sei, aber ich entgegnete ihr, das man nur einmal im Leben die Gelegenheit bekomme, einen solchen Menschen zu treffen. Wenn es der Präsident der Vereinigten Staaten sei, der mich eingeladen hätte oder zumindest Wolodymyr Selenskyj, dann sei das ja in Ordnung aber … soweit war sie gekommen, als ich sie unterbrach und sagte, zum Besuch beim Präsidenten der Ukraine würde ich meinen olivgrünen Pullover der Bundeswehr anziehen, den ich seit längst vergangenen Tagen im Kleiderschrank verstecke, falls er mir denn noch passt und die Einladung, die ich bekommen hätte, sei noch exklusiver als eine Einladung des US-Präsidenten, also möge sie bitte nicht meckern. Ohne ein weiteres Wort ging sie aus dem Zimmer.
Ich verstand sie ja. Im Gegensatz zu mir war sie nicht eingeladen worden zum 90. Geburtstag des Patriarchen. Sie hatte also allen Grund eifersüchtig zu sein.
Das Fest selbst fand im Park der Villa statt. Überall hingen Lampions in den Bäumen; die Gäste flanierten im Abendkleid und Abendanzug durch den Park; in der Hand hielten sie ihre Weingläser oder Champagnerkelche. Gruppen standen zusammen, plauderten, stießen an. Immer wieder hörte ich Geschichten vom Jubilar, die ganz unglaublich klangen. Wie der Patriarch als junger Mann seine Sippe durch die Wüste geführt hatte und keiner hatte geglaubt, dass es möglich sei, mehr als einen Monat in der staubtrockenen Wildnis zu überleben. Wie sie aber doch immer wieder Wasser gefunden hatten. Keiner der Gäste war dabei gewesen; dafür waren sie viel zu jung. Sie hatten die Geschichten von ihren Eltern gehört, die sie wiederum von ihren Vätern und Müttern gehört hatten. Einmal sollte dieser Mann, in höchster Gefahr durch die herannahenden Feinde, das Meer geteilt haben. Mit ausgebreiteten Armen habe er dagestanden und das Wasser getrennt, sodass es dastand wie hinter Glaswänden und dann seien die Vorfahren hindurchgezogen. Die Feinde seien mit gezogenen Schwertern hinterhergestürzt, die Streitwagen voran und dann habe der Patriarch die Arme sinken lassen und das Meer sei in sich zusammengestürzt und alle Feinde seien ertrunken.
So war das. So hörte ich es auf der Party. Wenn Sie es bezweifeln: bitte sehr. Ich kann ja auch nicht erklären, warum ich eingeladen war. Ausgerechnet ich. Wo alle anderen so viel prominenter waren. Jeder von ihnen stand im Lexikon oder mindestens auf Wikipedia. Da war ich in einer phantastischen Villa in einem phantastischen Park und die jungen Frauen und Männer erzählten mir Geschichten, die klangen, als hätten sie sie in „Netflix“ gesehen.
Nur den Patriarchen selbst konnte ich nicht sprechen. Ich habe ihm gratuliert, natürlich habe ich das, aber schon mein Geschenk konnte ich ihm nicht persönlich überreichen. Das nahm mir sogleich ein Diener ab.
Nein, tut mir leid, aber so geht das nicht. Ich bin zwar ein ganz passabler Geschichtenerzähler, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte die Geschichte falsch angefangen. Und zwar so falsch, dass es schon wehtut.
Nun wäre ich ein schlechter Prediger, wenn mir das aus Zufall passiert und ich das erst jetzt gemerkt hätte. Ich wollte Ihren Widerspruchsgeist wecken. Sie sollten selbst auf die Idee kommen, dass man Mose so nicht darstellen kann. Nicht als einen Patriarchen, der seinen 90. Geburtstag mit einem rauschenden Fest und illustren Gästen feiert. Das passt nicht zu einem Mann, der hundert Mal sein Leben riskiert. Schon gar nicht zu dem Mose, den wir hier erleben. Für den es Spitz auf Knopf steht und der kurz davor ist, die Brocken hinzuwerfen. Ja, ich weiß: Das ist nicht ohne weiteres erkennbar.
Fangen wir also noch einmal neu an.
Aber dazu müssen wir noch einmal ein Stück zurückgehen. Diese Geschichte erschließt sich nicht so ohne weiteres. Auch nicht dass sie eine Geschichte auf Leben und Tod ist. Sie beginnt eben nicht mit dem Wunsch des Mose, Gottes Angesicht schauen zu dürfen. Sie beginnt vielmehr mit dem Stierbild, das das wandernde Volk sich gemacht hat und das es für Gott hält. Mose selbst hätte das natürlich nie zugelassen, aber Mose ist zu der Zeit über den Wolken, hoch oben auf dem Berg Sinai um Gottes Gebotstafeln zu empfangen. Und damit beginnt die schwerste Krise der Wüstenwanderung des Volkes. Wahrscheinlich hatten sie gar nichts Böses im Sinn als sie ihr Gold einschmelzen ließen und es Aaron, dem Bruder des Mose gaben, damit er ihnen ein Stierbild, das sogenannte „Goldene Kalb“ machte. Ich glaube nicht, dass sie sich einen anderen Gott wünschten, als den, den sie verehrten und der sie aus Ägypten ins Gelobte Land führen würde. Nur sichtbar sollte er sein und vermutlich auch ein wenig zugänglicher als Jahwe es war, der unsichtbare und unverfügbare Gott, den sie kannten. Dass die Bibel das Götterbild als „Goldenes Kalb“ bezeichnet, ist wenig verwunderlich; damit soll es herabgesetzt und lächerlich gemacht werden. Wer wollte schon ein Kalb anbeten?
Aber das ist natürlich aus der Perspektive derer erzählt, die es immer schon besser wussten. Oder meinetwegen aus der Perspektive Gottes. Die Perspektive der Menschen sieht anders aus. Sie wollen einen Gott, der sich nicht ins unnahbare Dunkel verzieht. Sie brauchen einen, der nahbar ist, sichtbar; den sie vielleicht sogar berühren können. Die alte Frage, ob sie das Bild für den Gott selbst hielten, ist leicht beantwortbar. Natürlich wussten sie, dass das Bild nicht Gott selbst ist, sondern nur ein Symbol. Zumindest die Klügeren unter ihnen wussten es.
Doch, ich kann sie verstehen. Sie sind in der Wüste. Sie haben keine Ahnung, ob sie das Gelobte Land jemals erreichen werden. Von Tag zu Tag leben sie buchstäblich von der Hand in den Mund. Jeder Abend kann der letzte sein. Und nun ist auch noch ihr Anführer im Dunkel der Wolken verschwunden. Ob er je wiederkommen und sie aus der Wüste herausführen wird, wissen sie nicht. Wer könnte nicht verstehen, dass sie nach einem Rettungsanker greifen; selbst wenn es nur eine Skulptur ist, die sie selbst gemacht haben? Diese Geschichte kommt mir ungeheuer modern vor. Sie erzählt auch von uns, von unseren Ängsten, dass der Krieg in der Ukraine sich ausweitet, dass Russland die Nato angreift und dass es dann nicht mehr weit ist, bis die Atomraketen fliegen und die Erde unbewohnbar wird wie der Mars. Oder dass wir mit unserem ungeheuren Energiehunger und unserer Gier nach Wachstum uns über kurz oder lang unser eigenes Grab schaufeln. Das Gefühl, dass morgen alles vorbei sein kann, haben wohl nicht nur die, die sich die „Letzte Generation“ nennen. Da wäre ein Gott, der ein bisschen nahbarer wäre, schon eine ziemliche Beruhigung.
Woraufhin Gott ein furchtbares Strafgericht durchführen lässt. Und Mose ist es, der es vollstrecken muss.
Und dann? Dann wird das Grauen auch ihn ergriffen haben. Und die Frage, ob es das wert war. Ob es überhaupt noch eine Zukunft gebe. Dann beginnt das Ringen mit Gott. Es scheint so, als ob Mose am Ende und alle Gewissheit verflogen ist. Er weiß nicht mehr weiter. Er will ein Zeichen. Ohne ein Zeichen kann er nicht weiter. Also fordert er von Gott, er möge sich zeigen.
Stockt einem da der Atem? Oder sollte man diese Wendung ironisch nennen? Sind die Israeliten nicht gerade dafür bestraft worden, dass sie Gott unverhüllt sehen wollten? Was, bitte, ist an dieser Forderung anders? Außer der, das Mose nicht eine Statue sehen will, sondern Gott selbst, Gott unverhüllt.
Schwierig, nicht zu denken, dass der Blitz nicht im nächsten Augenblick den Frevler niederstreckt: Aber wie gesagt: Es geht um alles. Und zwar für beide: Mose und Gott. Darum weist Gott die Forderung auch nicht komplett ab. Mose darf zwar nicht sein Angesicht schauen, aber er stellt ihn in eine Höhle und er darf Gott nachschauen.
Später wird so etwas nur noch von einem Menschen erzählt: dem Propheten Elia. Und auch der ist in einer ganz ähnlichen Krise wie Mose.
Aber nun frage ich mich, ob wir diese Geschichte überhaupt auf uns übertragen dürfen. Sie ist so einzigartig und auch so groß, dass man das bezweifeln kann. Wie gesagt: es gibt nur noch einen Propheten, von dem ähnliches erzählt wird. Das ist Elia. Seine Verzweiflung ist ähnlich intensiv.
Nun müssen wir zugeben, dass wir uns nicht mit Mose oder Elia messen können. Beider Aufgaben waren übermenschlich. Ebenso ihre Gefühle, als sie den Eindruck hatten, gescheitert zu sein. Andererseits stellt uns ein solcher Predigttext vor die Aufgabe, einen Anknüpfungspunkt zu suchen. Den sehe ich in dem Wunsch, Gott zu schauen. Oder wenigstens so mit ihm sprechen zu können, wie Mose mit ihm gesprochen hat. Natürlich können wir zu ihm beten und manchmal bekommen wir auch eine Antwort, aber hin und wieder haben wir doch das Gefühl, Gott höre uns nicht.
Wir würden ihn gern sehen. Schon allein, weil es schwierig ist, den Glauben in einer Welt zu leben, die immer weniger von diesem Gott zu wollen scheint. Wir würden ihn gern sehen, weil die Sprache, in der wir von ihm reden, immer dürftiger und abgegriffener wirkt.
Erst recht möchten wir ihn sehen, wenn der Zweifel kommt. Der sich in uns hineinfrisst. Der vielleicht klein anfängt, aber dann immer mehr nagt. Der uns womöglich sagt: Was nützt es, Gott um etwas zu bitten? Er hilft ja doch nicht. Womöglich ist er weit weg von uns oder er ist genauso ohnmächtig wie wir. Er kann nichts ändern: nicht am Krieg in der Ukraine, nichts am Klimawandel, auch nichts an unseren persönlichen Lebensumständen.
Und dann beginnt der Kampf. Dann beginnt der Kampf mit Gott. Nein, das ist nicht polemisch gemeint. Ich glaube, dass dieser Kampf manchmal notwendig ist. Schließlich hat auch Mose mit ihm gekämpft. Als er das Volk Israel vernichten und Mose zum neuen Volk machen wollte, hat er ihn daran erinnert, dass er es war, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten gerettet und versprochen hat, sie in das Gelobte Land zu führen. Und er hat nicht aufgegeben, bis Gott versprochen hat, auch weiterhin für das Volk da zu sein. So gewiss keiner von uns Mose ist und eine solche Aufgabe zu schultern hat, so gewiss bleiben auch uns die Krisen nicht erspart. Und im Grunde können wir gar nicht anders, als diese Krisen mit Gott in Verbindung zu bringen. Jetzt sage ich sogar: Ich hoffe, dass wir diese Krisen mit Gott in Verbindung bringen. Weil das zeigt, dass wir von Gott noch etwas erwarten. Dass er uns immer noch wichtig ist.
Sie ahnen es: Ich spreche vom Gebet. Gerade in solchen Situationen mag es uns fernliegen. Und doch ist es wichtig, dass wir vor Gott zur Sprache bringen, was uns bedrückt. Vielleicht können wir nur stammeln. Vielleicht zweifeln wir daran, dass unser Gebet etwas nützt. Und doch sollten wir unsere Sache vor Gott bringen. Wenn es sein muss, immer und immer wieder.
Unser Predigttext ermutigt uns dazu. Er sagt: Gott hört uns. Er hört uns zu. Und manchmal lässt er sich sogar umstimmen.
Pfr. i.R. Bernd Giehl
Mainz
E-Mail: giehl-bernd@t-online.de