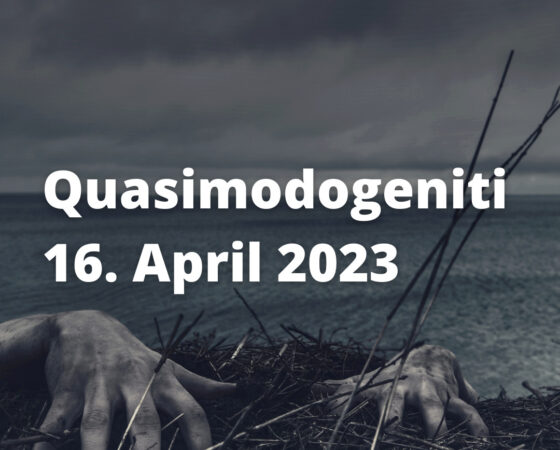Die nachösterliche Sicht | 1. Mose 32,23-32 | Quasimodogeniti | 16. 04.2023 | Gerlinde Wnuck |
Liebe Gemeinde,
sonntags höre ich manchmal die Zwischentöne im DLF. Vor ein paar Wochen wache ich mitten in der Nacht auf und schalte in die Wiederholungssendung ein. Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ist da im Gespräch mit der Moderatorin über ihr sog. Hoppe-Buch, darin hat sie ihre eigene Biographie aus der Sicht als sie 6 Jahre alt war geschrieben. Und weil das eigentlich ein Unding ist, als erwachsene Frau sein Leben aus der Sicht eines Kindes zu schreiben, das seine ganze Zukunft noch vor sich hat, befragt die Moderatorin die Schriftstellerin, ob sich da die kleine Felicitas ihr Leben im Buch erfindet bzw. erfinden muss. Anders gefragt: Was ist daran die echte Hoppe?, will die Moderatorin wissen. Felicitas Hoppe antwortet für mich überraschend. Sie erzählt, dass sie in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen ist, durch ihre Mutter habe sie den großen Erzählschatz der Bibel kennenlernen können. Und aus ihrer Sicht hätte die Mutter auch jetzt auf die Frage, ob das Hoppe-Buch denn wirklich eine Biographie genannt werden könne, geantwortet: „Sagen wir, das ist die nachösterliche Sicht.“
Die nachösterliche Sicht! Will sagen, da scheint was Wesentliches aus meinem Leben durch. Wird sichtbar und spürbar, was mir in diesem Leben geschehen ist.
Liebe Gemeinde, in jener Nacht bei den Zwischentönen im DLF habe ich den Faden für meine Predigtidee aufgenommen. Ich möchte mit Ihnen nachdenken über die Frage, was bedeutet eigentlich „die nachösterliche Sicht auf das eigene Leben“.
Taste ich mich da langsam heran, gibt mir heute der 1. Sonntag nach Ostern einen Hinweis. Der „Weiße Sonntag“, wie er auch heißt. Wir sind an den Festtagen noch ganz nah dran. Der „Weiße Sonntag“ hat einmal die nachösterliche Festwoche abgeschlossen. Am 8. Tag nach Ostern feiern Kinder noch heute in katholischer Tradition oft weiß gekleidet ihre Erstkommunion. In der frühen Kirche legten die in der Osternacht getauften Erwachsenen an diesem 8. Tag nach Ostern ihre weißen Taufkleider ab. Eine Woche lang übten sie sich in die neu gewonnene, nachösterliche Sicht auf ihr Leben ein. An jedem Tag in dieser Woche nach Ostern wurde Gottesdienst gefeiert und sie erinnerten sich daran, dass sie mit Jesus in die Nacht seines Todes hineingetauft waren, um in seinem Licht zu leben. Daher trägt der Abschluss-Sonntag dieser Festoktav den Namen der „Weiße Sonntag“. Weiß ist die Farbe des Lichts. Da sind wir ganz nah dran an dem Glüh- und Brennpunkt des christlichen Glaubensgrundes!
Jeder Tag soll ein „schöner Ostertag“ sein. Jeden Morgen erklingt der österliche Weckruf: „Ihr Menschen kommt ins Helle!“ (EG 117,1). Wo immer eine herkommen mag, aus Trauer, aus Müdigkeit, aus Antriebsschwäche, aus Lustlosigkeit – Ostern spiegelt etwas von dem Gefühl wieder: Wow. Ein neuer Tag – ich fühl mich wie neu geboren.
Viele Osterlieder beschreiben den Glühpunkt des Glaubens wie die Erfahrung einer Morgendämmerung, wo das Licht des neues Tages wie ein zarter Hauch von Rosa-rot am Himmel ersteht und das Morgengrauen mit leichten Federstrichen andeutet: „Wenn ich des Nachts oft lieg in Not / verschlossen, gleich als wär ich tot, / lässt du mir früh die Gnadensonn / aufgehn: nach Trauern Freud und Wonn. / Halleluja.“ (EG 111,2)
Ja. Nachösterlich ist eine Sicht – wo immer Menschen ein Dunkel durchschreiten müssen, bis sich ihnen ihr Leben von neuem erhellt. Oft sind es Krisen, aus denen Menschen verändert hervorgehen. Man könnte auch sagen: Sie strahlen eine Tiefe aus, die sie – um ein altes Wort zu nehmen – „glaubwürdig“ macht, heute sprechen wir dann: eine Person ist authentisch und meinen, dass ihre Weise zu leben und sich zu äußern auch ahnen und durchscheinen lässt, dass sie sich auf ihrem Weg auch Erfahrungen des Dunklen stellen musste.
Tasten wir uns weiter vor. Der Weiße Sonntag gibt uns einen ersten wichtigen Hinweis. Sind es aber nicht zwei Jahrtausende, die uns von dem realen Geschehen damals – dort trennen! Das erweitert die nachösterliche Perspektive erheblich. Lessing sprach vom sog. garstigen Graben und machte in diesem Bild eine Not anschaulich, dass das, was im ersten Frühling des noch jungen christlichen Glaubens so lebendig war, nun durch den wachsenden Abstand in unserem Empfinden blasser und blasser wird.
Der garstige Graben ist eine breite Furt mit gefährlichen Wasserschnellen, die einen weit von dem Ursprung der ersten Botschafterinnen des Osterglaubens fortreißen können: In Stürmen von Zweifeln, vor allem durch Irritationen aufgrund einer wenig überzeugenden und in weiten Teilen dunklen Christentumsgeschichte, salopp gesagt: „Jesus verkündete das Reich Gottes – gekommen ist die Kirche“ – und mit ihr die unheilige Verkrautung mit gewaltvollen politischen Machtstrukturen, wenn wir an die Zeit der Kreuzzüge im Mittelalter denken, die Glaubenskriege nach der Reformation. Oder wir sehen zur Zeit im Fernsehen die zahlreichen Dokumentationen und Filme über die Zeit des Nationalsozialismus und darin verwickelt das verhängnisvolle Mitläufertum eines großen Teils der Kirche, auch da, wo sie schwieg, ein Mitläufertum, das sich unbegreiflicherweise gegenwärtig in der russisch-orthodoxen Kirche, dem Patriachat Cyrills an Putins Seite wieder findet.
Sie werden mir zugeben: Diese andere reale, einen atemlos machende nachösterliche Sicht beschwert durchaus den Glauben! Und es gibt einen guten Grund auch heute noch mit den Frauen der ersten Stunde zu fragen: Wer rollt uns den schweren Brocken der zweitausendjährigen Geschichte von des Grabes Tür?! Denn wenn es nur diese dunkle Seite gäbe und nicht auch die Lichtpunkte der vielen Menschen und Namen und Bewegungen, die wir bis heute erzählen und erinnern, Namen wie Anne Frank, Sophie und Hans Scholl, Martin Luther King, Nelson Mandela, Janusz Korczak, Simone Weil und viele andere … Menschen, die für den Glauben an Jesus glühten und ihr Leben riskierten – wären wir heute im Jahr 2023 nach Ostern nicht hier bzw. wir glaubten umsonst –
Doch niemand ist umsonst, d. h. grundlos hier. Wir alle haben einen Faden in unserem Leben aufgenommen, mal fester, mal lockerer sehen wir uns an der Seite der ersten Vorkämpferinnen der Jesusbewegung, sehen uns im inneren Gespräch, z. B. mit Thomas, ihn treiben Zweifel um, bis er den Finger in die Wunde legen darf. Oder wir denken an Petrus beim Hahnenschrei. Wir begegnen den verweinten Augen der Maria, die glaubt den Gärtner im Garten zu sehen und erst im Nachhinein als Jesus sie beim Namen ruft, weiß sie: Er ist es, er lebt.
Auch wir kennen solch tiefe Trauer, die in Freude umschlagen kann. Wir kennen nagenden Zweifel, der den Glauben doch allererst schärft. Wir teilen die Erfahrung in manchen Zeiten und Lebenswenden, dass wir uns fragen, wer bringt uns die schweren Brocken der eigenen Lebensgeschichte von des Grabes Tür weg? Im Nachhinein wird der Blick frei. Wie die Frauen am Ostermorgen – mit der ersten Morgendämmerung als ihnen die Sonne aufgeht, erkennen sie „er, den wir lieben dürfen – trägt unser Kreuz ins Leben“ (nach EG117,2)
Wenn wir taufen, zeichnen wir mit dem Wasser der Taufe ein Kreuz auf die Stirn. So sind wir gesegnet durch das Kreuz. Ins Licht des Lebens gestellt. Jeden Tag neu ins Licht gerufen. Und selbst, wenn die Taufe 50 Jahre, oder 70 oder 90 Jahre zurückliegt – auch am Ende des Lebens bleibe ich gesegnet durch das Kreuz.
Dieses Segenszeichen ist wie ein Wasserzeichen auf einem wertvollen Papier. Ein Wasserzeichen ist eigentlich unsichtbar. Ins Licht gehalten scheint es durch.
Nachösterlich gesehen scheint das Kreuz in allem durch, was Menschen überhaupt durchmachen müssen auf allen Längen- und Breitengraden dieser Erde, die sich kreuzen. So wird das Kreuz zum Wasserzeichen der ganzen Schöpfung. Wir kennen doch nicht nur eigenes Leid! Um wie viel mehr wird uns heutzutage durch die Medien anderer Völker Leid, das so viel größer ist, manchmal zum Verzweifeln vor Augen gebracht. Durch unser Mitgefühl sind wir mit den Lebensfäden so vieler verwoben, die unsichtbar die Breiten- und Längengrade unserer Erde kreuzen.
Ich denke an Dascha, eine junge Polin. 22 Jahre. Sie studierte bis vor einem Jahr Jura, doch die Not im Nachbarland der Ukraine ließ sie nicht los, sie nahm ein Urlaubssemester, anstatt Anwältin zu werden, ließ Dascha sich zur Sanitäterin ausbilden, seitdem ist sie fast pausenlos für eine Hilfsorganisation in Lwiw unterwegs. In Hilfskonvois holt sie mit ihrem Onkel alte Menschen, Kranke und Verletzte aus der Ukraine nach Polen. Über 220 000 km haben sie hinter sich gelegt.
Dascha sagt, wenn du hier bist und wirklich siehst, was passiert … alte Frauen, die ohne Strom und Wasser in ihren Häusern überleben müssen, Kinder, die kaum mehr aus Luftschutzkellern herauskommen und die dort erfahren müssen, dass ihre Väter dort an der Front gestorben sind… dann ist es nicht einfach möglich zum normalen Leben zurückzukehren, in eine Disco zu gehen, mit Freunden auszugehen oder sich einen Film im Kino anzusehen. … ich hab kein normales Leben mehr, kaum bin ich in Polen zuhause, treibt es mich zurück.
Das ist die Ambivalenz der Erfahrung des Helfens – es bekümmert unendlich und setzt doch frei. Nicht anders erleben es Menschen bei uns in der Asylarbeit, im Engagement um mehr Klimagerechtigkeit, in der Nachbarschaftshilfe. Jeder Einsatz in der Pflege kostet Zeit und auch viel seelische Kraft – und setzt doch auch Licht frei.
Hat Dascha sich echt so ihr Leben vorgestellt?
Dascha weiß, dass ihre Vorfahren im 2. Weltkrieg zuhause Juden vor den Nazis versteckt haben. Sie kennt die Sicht ihrer Familie auf das Leben.
„Sagen wir, das ist die nachösterliche Sicht.“ Ein bleibender Weckruf aus dem Dunkel ins Licht zu kommen.
Ich möchte Sie einladen, den Faden etwas aufzunehmen. Jede und jeder für sich. Dazu erklingt jetzt etwas Musik von der Orgel.
Musikalische Improvisation
Eine Frau zeigte mir bei einem Besuch ein Bild von Marc Chagall. Manche werden es kennen: Es zeigt eine Szene aus der Erzählung ‚Jakobs Kampf am Jabbok’. Wir haben sie in der Lesung gehört. „Es ist eins meiner Lieblingsbilder“, sagt die Frau. Und sie erzählte mir:
Viele Jahre ihres Lebens wunderte sie sich über eine übergroße Narbe, die sich von ihrer unteren Wirbelsäule über ihre rechte Hüfte zog. Sie hatte dafür keine Erklärung. Und da sie im 2. Weltkrieg in eine kinderreiche Familie hineingeboren war, vergaß sie auch dieses geheimnisvolle Zeichen an ihrem Leib. Jahre später erhellte sich, was mit ihr geschehen war. Sie sagt: „Festgewachsen an der Uteruswand meiner Mutter und mit der Nabelschnur um den Hals kämpfte ich um mein Leben – ein Kampf auf Leben und Tod. Schließlich reißt die Verbindung, rettet uns beiden das Leben. Durch den Kampf und den Abriss entstand eine blutende Verletzung an meiner Hüfte, deren Narbe noch heute sichtbar ist. „Viel später erschloss sich mir“, erzählte die Frau, „dass diese lebensbedrohliche, verletzende Erfahrung das kostbarste Geschenk meines Lebens enthält.“ Sie sagt: „Das ist bis heute prägend für mich: die reale Erfahrung des Göttlichen.“
Eine berührende Erfahrung. Da nimmt Jahre später eine den Faden aus ihrer frühesten Biographie auf und erkennt in der Erzählung von Jakobs Kampf am Jabbok, in seinem Ringen auf Leben und Tod und seiner Segnung, was ihr konkret vorgeburtlich geschehen war.
Spannungsreich ist Jakobs Geschichte. Spannungsreich in der Ambivalenz der Erfahrungen. Wie ein Nachtgesicht erschien Jakob die gefährliche Gestalt am Fluss, ein Albtraum das Dunkel solcher Erfahrungen. Und dennoch! Jakob nannte die Stätte Pniel: Gottesgesicht.
Diese Ambivalenz der Erfahrung, die manchmal Menschen machen, dass dort, wo sie sich einem Dunkel stellen mussten, ein Leuchten zurückbleibt – ein Segen, eine Dankbarkeit –
Jochen Klepper verdichtete diese Erfahrung in diesen Worten: „Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.“ (EG 16,5)
Sagen wir, das ist die nachösterliche Sicht.
Hören wir den Text aus dem 1. Buch Mose, Kap. 32, Verse 23-33 – in einer Nacherzählung (erzählt nach Martin Buber):
In jener Nacht machte er sich auf, er nahm seine zwei Weiber, seine zwei Mägde und seine elf Kinder und fuhr über die Furt des Jabbok, er nahm sie, führte sie über den Fluss und fuhr herüber, was sein war. Jaakob blieb allein zurück. –
Da rang einer mit ihm, bis das Morgengrauen aufzog.
Als jener sah, dass er Jaakob nicht übermochte, rührte er an seine Hüftpfanne, und Jakobs Hüftpfanne verrenkte sich, wie er mit ihm rang. Dann sprach jener: Entlasse mich, denn das Morgengrauen ist aufgezogen.
Jaakob aber sprach: Ich entlasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet.
Da sprach jener zu ihm: Was ist dein Name?
Und er sprach: Jaakob.
Da sprach jener: Nicht Jaakob werde fürder dein Name gesprochen, sondern Jißsrael, Fechter Gottes, denn du fichtst mit Gottheit und mit Menschheit und übermagst.
Da fragte Jaakob, er sprach: Vermelde doch deinen Namen!
Jener aber sprach: Warum denn fragst du nach meinem Namen!
Und er segnete ihn dort.
Jaakob rief den Namen des Ortes: Pniel, Gottesantlitz, denn: Ich habe Gott gesehn, Antlitz zu Antlitz, und meine Seele ist errettet.
Die Sonne strahlte ihm auf, als er an Pniel vorüber war, aber er hinkte an seiner Hüfte.
Der Friede Gottes… Amen.
—
Quellen:
Zwischentöne mit Felicitas Hoppe vom 19.03.2023, https://www.deutschlandfunk.de/zwischentoene-mit-felicitas-hoppe-vom-19-03-2023-musik-gekuerzt-dlf-e543c45f-100.html
Bis an die Grenzen der Erschöpfung – 22jährige Polin als Helferin in der Ukraine, https://www.deutschlandfunk.de/bis-an-die-grenzen-der-erschoepfung-22jaehrige-polin-als-helferin-in-der-ukraine-dlf-d71be54c-100.html
Die fünf Bücher der Weisung, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Deutsche Bibelgesellschaft, 1976, 10. Auflage, Bd. 1, 95.
auch: https://bibel.github.io/BuberRosenzweig/ot/1.Mo_32.html