Glauben und Bekennen in den Weltreligionen?
Predigt in der Sommer-Predigtreihe zum Thema CREDO in der Marktkirche Goslar (27. Juli 2025)
„Glauben und Bekennen in den Weltreligionen?“
Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus
Die Türme der Markkirche
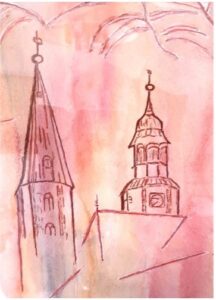
(Bild von Renate Schmid, Goslar)
Liebe Gemeinde!
„Glauben und Bekennen in den Weltreligionen?“ – Welche Herausforderung für eine Predigt?! Deshalb auch das Fragezeichen hinter dem Titel.
Ich beginne mit einem Erlebnis. Im Oktober 1980 waren wir zu einer Studienreise in Indien unterwegs, zusammen mit meinem religionspädagogischen Kollegen Hans Grothaus und einer Gruppe von Studierenden aus Flensburg. Als wir in Benares im Morgenlicht eine Bootsfahrt auf dem Ganges gemacht hatten, das rituelle Bad der Pilger gesehen, den Klang der Tempelglocken gehört, den süßlichen Rauch der Scheiterhaufen gerochen, den Rhythmus des Lebens und Sterbens am heiligen Wasser wahrgenommen hatten, fragte mich der katholische Inder, der uns führte, mit welchen Zielen wir nach Indien gekommen seien. Ich zählte unsere „Lernziele“ auf: Kennenlernen des Hinduismus, Begegnung mit Christen in Indien, Besichtigung von Entwicklungsprojekten. Er zog die Augenbrauen hoch: „Haben Sie vor, mit einem Becher einen Ozean auszutrinken?“ Das Bild vom Becher und vom Ozean begleitete mich künftig auf den Wegen des Erkundens und des Staunens über die Vielfalt und Unendlichkeit der östlichen Religiosität, wobei ich manchmal denke, dass auch der Becher wenigstens den Geschmack vom Ozean geben kann. Ich möchte Sie heute ein wenig mit mir aus diesem Becher trinken lassen. Dazu greife ich nicht nur auf zentrale Überzeugungen in den verschiedenen Religionen zurück, sondern erzähle von Menschen, die diese Überzeugungen geteilt haben, mit ihnen gelebt haben und verantwortlich nach ihnen gehandelt haben. Ich möchte heute nicht entfalten, wie religiöse Motive ausgenutzt werden können, um Abgrenzungen, Verurteilungen und Unterdrückungen anderer, ja sogar Kriege zu rechtfertigen. Das könnte ich auch – mit Blick auf evangelikale Trump-Unterstützer, russisch-orthodoxe Putin-Verehrer, die Ideologie von jüdischen Siedlern mit ihren Angriffen auf die Westbank, das betonharte islamische Regime im Iran, Buddhisten in Myanmar, die Muslime verfolgen, und Hindu-Nationalisten in Indien. Aber es gibt auch das Gegenteil – viel breiter und viel stärker, als den meisten von uns im Bewusstsein ist. Ich suche nach Spuren eines Glaubens, der aus den spirituellen Wurzeln, die in jeder Religion ganz spezifisch sind, Kraft schöpft für ein verantwortliches Leben. „RELIGION MACHT FRIEDEN“, so heißt ein spannendes Buch von Markus Weingardt[1] über religiöse und interreligiöse Friedensstifter. Ich erzähle von Persönlichkeiten, die mir begegnet sind, einige in Büchern, sehr viele persönlich bei unseren Nürnberger Foren zur Kulturbegegnung, auf Reisen, bei Konferenzen. Menschen, die auf der Aufbruchslinie ihrer Gemeinschaften stehen, die nicht nur die Vision einer heilvollen Zukunft haben, sondern dafür leben, sie jetzt schon wirklich werden zu lassen.
Ich beginne mit dem Hinduismus, der wohl ältesten der Weltreligionen. Sanatana Dharma – „ewige Ordnung“, „ewige Religion“ ist die Bezeichnung, die Hindus selbst für ihre Religion verwenden. Darauf können sich die oft ganz verschiedenen Richtungen des Hinduismus in ihrer unendlichen Vielfalt beziehen: eine Ordnung, die alles Leben bestimmt und an die sich alle halten sollen, unabhängig davon, in welcher Klasse oder Kaste sie sind. Mahatma Gandhi hat von den damit verbundenen Werten her gelebt und gehandelt, besonders im Blick auf Wahrheit, Gewaltlosigkeit und selbstkontrollierten Lebenswandel. 5 Vorsätze für jeden Tag hat er sich vorgenommen, unverändert herausfordernd bis heute: 1) Ich will bei der Wahrheit bleiben. 2) Ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen. 3) Ich will frei sein von Furcht. 4) Ich will keine Gewalt anwenden. 5) Ich will in jedem zuerst das Gute sehen. Mir steht eine Freundin vor Augen, die ich in Indien habe: Vinu Aram, die als Ärztin den Shanti Ashram leitet, den „Friedens“-Ashram, eine von geistlichen Werten getragene Gemeinschaft, die eine beispielhafte medizinische, Bildungs- und Umweltarbeit leistet in einer der besonders armen Regionen in Indien. Sarvodaya – „Wohlfahrt für alle“ – ist das Prinzip, das sie von Gandhi übernommen hat. An der Universität Harvard ausgebildet, ist sie trotz bester Karriere-Aussichten dort in den Ashram zurückgekehrt, den ihre Eltern aufgebaut haben und mit dem sie 250.000 Menschen in der Region erreicht, darunter 70.000 Kinder.
Wenn wir weitergehen zum Buddhismus, der seine Ursprünge ja auch in Indien hat, dann können wir auf das Bekenntnis der Deutschen Buddhistischen Union zurückgreifen, auf das sich die verschiedenen buddhistischen Gruppen in Deutschland geeinigt haben[2]: „ICH BEKENNE MICH ZUM BUDDHA, meinem unübertroffenen Lehrer. Er hat die Vollkommenheiten verwirklicht und ist aus eigener Kraft den Weg zur Befreiung und Erleuchtung gegangen. Aus dieser Erfahrung hat er die Lehre dargelegt, damit auch wir endgültig frei von Leid werden.
ICH BEKENNE MICH ZUM DHARMA, der Lehre des Buddha. Sie ist klar, zeitlos und lädt alle ein, sie zu prüfen, sie anzuwenden und zu verwirklichen.
ICH BEKENNE MICH ZUM SANGHA, der Gemeinschaft derer, die den Weg des Buddha gehen und die verschiedenen Stufen der inneren Erfahrung und des Erwachens verwirklichen …
Uns steht sicher der Dalai Lama vor Augen, der am 6. Juli seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Die Lehre des Buddha hat ihn zum globalen Friedensboten werden lassen. Aus der Erkenntnis des Buddha, dass alles, was lebt und existiert, vergänglich und vom Leiden betroffen ist, hat er das Mitgefühl für alles Lebende und Leidende entwickelt. Das Freiwerden vom Egoismus, von Gier wie von Hass, ist dazu notwendig. Einmal bin ich ihm persönlich begegnet. Er ging auf mich zu, und da ich mein Kollar-Hemd anhatte, wies er auf mich und sagte: „Monk“ = Mönch. Und wies dann auf sich selbst und sagte: „Monk“. Er meinte: Wir beide sind Geistliche. Zwei seiner Freunde und Mitstreiter habe ich persönlich kennengelernt: A.T. Ariyaratne, den man den Gandhi Sri Lankas nennt. Er hat wie Vinu Aram eine Sarvodaya-Bewegung ins Leben gerufen: Wohlfahrt für alle! Mit ihr ist er in 15.000 Dörfern der Insel präsent: Achtsamkeit für alles Lebende und Existierende ist sein Motto. Bildungsarbeit, Frauenarbeit, ökologisches Wirtschaften wird in diesen Dörfern praktiziert. Der Zweite ist Sulak Sivaraksa, führender Buddhist in Thailand, der die Bewegung des „engaged Buddhism“ ins Leben gerufen hat, des „engagierten Buddhismus“. Sivaraksa versteht sie als Gegenbewegung gegen die allgegenwärtige Religion des ungebremsten Verbrauchs und der Naturausbeutung. Eine Versammlung der Armen hat er zusammengerufen, ein „Parlament der Armen“ wird sie genannt. Wegen seiner Regierungskritik ist er mehrfach im Gefängnis gewesen. Aber er hat auch den Alternativen Nobelpreis erhalten. Kraft schöpfen Ariyaratne und Sivaraksa aus der Meditation, dem regelmäßigen Einüben der Selbstlosigkeit und der Achtsamkeit.
Wenn ich jetzt auf Judentum, Christentum und Islam zu sprechen komme, treten wir gleichsam in eine andere Religionswelt ein: mit dem Glauben an den einen Gott, den Schöpfer und Erhalter, den Richter und Retter: den Monotheismus. Und doch gibt es auch viel Verbindendes mit den Werten von Hinduismus und Buddhismus, vor allem, was das Wissen um die Verbundenheit mit allem Lebenden und Existierenden angeht und ebenso um die ethischen Gebote. Das hat vor allem Hans Küng herausgearbeitet mit seinem Projekt Weltethos.
Für das Selbstverständnis des Judentums gibt es einen zentralen Text, der im 5. Buch Mose, dem Deuteronomium, steht: »Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. …Und wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt: er hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben …: nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat.« (5 Mose/Dtn 6,4ff.)
Dieser Abschnitt führt in die Mitte des Judentums hinein: in die tiefe Verbundenheit mit Gott, die Liebe zu ihm, die sich auch in vielen Bräuchen und Riten ausdrückt. Die Worte weisen auch auf die Verheißung des Landes, die auf Gottes Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob zurückgeführt wird. Und sie erinnern an die Anfangsgeschichte Israels, die als Befreiungsgeschichte aus der Sklaverei erfahren wurde. Sie ist die Grundlage für die 10 Gebote, die für das Christentum und den Islam ebenso gelten. Zusammengefasst sind sie in dem Doppelgebot der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, wie Jesus es dann auch wiedergibt. Besonders hervorgehoben wird im Judentum die Aufnahme von Fremden im eigenen Land: Fremde sollen im eigenen Land wohnen wie Einheimische. Damit wird daran erinnert, dass Israel ja selbst ein Fremdling in Ägypten gewesen ist. Persönlich denke ich dabei an das Schicksal von Arno Hamburger, der in den 1920-er Jahren als jüdischer Junge in Nürnberg aufwuchs, dann mit dem letzten Kindertransport vor dem 2. Weltkrieg nach England kam, nach Palästina auswanderte und Soldat in der britischen Armee wurde. Als er nach Ende des Krieges nach Nürnberg trampte, fand er seine Eltern – lebend – versteckt in der Leichenhalle des jüdischen Friedhofs! Er wirkte danach als Übersetzer bei den Prozessen gegen die Nazi-Ärzte, übernahm die Firma seines Vaters und baute die Israelitische Kultusgemeinde neu auf. Dazu gehört eine schöne Synagoge, ein Altenheim, das in Nürnberg als vorbildlich gilt, und seit kurzem eine Kita, die auch nichtjüdische Kinder aufnimmt. Als Arno Hamburger nach dem dem Terror des 11. September 2001 im Rahmen unserer Nürnberger Gruppe der Religionen für den Frieden an einer Gebetsstunde teilnahm, die wir in einer Moschee halten konnten, trug er die Worte des Propheten Jesaja von den Schwertern vor, die zu Pflugscharen umgeschmiedet werden sollen. Es war ein bewegendes Zeichen gegen allen religiösen Extremismus. Gegenwärtig bedrückt uns, dass die ultra-religiösen Hardliner in der Netanjahu-Regierung so viel Einfluss auf die Expansionsgelüste der Siedler haben, die die Westbank terrorisieren. Es kommt da zu regelrechten Zerstörungen und Vertreibungen. Ich bekomme aber regelmäßig die Nachrichten von Rabbis for Human Rights, den Rabbis für Menschenrechte, die auf die Westbank fahren, um den palästinensischen Bauern beim Pflanzen und Ernten zu helfen und sie gegen die Siedler zu schützen. Sie handeln damit in Treue zu dem Grundbekenntnis jüdischen Glaubens.
Wenn wir uns jetzt dem christlichen Glauben zuwenden, dann bezieht sich unser Bekenntnis zentral auf den Juden Jesus von Nazareth. Was er für uns bedeutet, haben wir vorhin in dem neuen Glaubensbekenntnis ausgedrückt. In Jesus begegnet uns gleichsam das Gesicht Gottes, Gottes Gegenwart unter uns.
„Wir glauben an Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder.
Er weist uns den Weg mit seinen Worten und Taten. Er zeigt uns dich als unseren Vater mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Er steht uns bei. Er leidet unser Leid mit, und er stirbt mit uns unseren Tod. Er überwindet den Tod und führt uns aus dem Tod ins Leben.“
Dass Gott in Jesus mit uns unseren Weg als Menschen geht, ist das Besondere, das Spezifische des christlichen Glaubens. Was das für uns, in unserem Leben bedeuten kann, hat Dietrich Bonhoeffer in seinen Gebeten für Mitgefangene zum Ausdruck gebracht. Er redet Jesus direkt an: „Herr Jesus Christus, Du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich. Du willst, dass ich dich erkenne und mich zu Dir kehre. Herr, ich höre Deinen Ruf und folge, hilf mir!“[3]
Ich möchte dazu von einem katholischen Freund unserer Familie erzählen, der diesen Ruf ernst genommen hat. Guiseppe Frizzi heißt er, Peppino nennen wir ihn. Er stammt aus einer kinderreichen italienischen Familie. Als junger begabter Priester kam er zu uns nach Münster und nahm an unserem Tanzkreis teil, weil er für seine spätere Jugendarbeit gerne Volkstänze gestalten wollte. Er schrieb eine Doktorarbeit im Neuen Testament. Danach arbeitete er in einem Armensiedlung in Lissabon – mit Kindern und Jugendlichen, mit denen er auch Volkstänze übte und sogar einen Preis beim Stadtwettbewerb gewann. Er lernte gründlich Portugiesisch, um dann in Mozambique in Afrika Dienst zu tun. Er ging dorthin, obwohl in dem Land Bürgerkrieg herrschte. Aber Peppino ließ sich nicht beirren und reiste aus nach Mozambique. Er lebte und lebt dort bis heute unter einfachsten Verhältnissen mit den Menschen zusammen, auch in der Zeit des Bürgerkrieges. Längere Zeit musste er im Hausarrest verbringen, bis sich die Lage wieder besserte. Einmal im Jahr wenigstens ist immer ein Brief zu uns gekommen; und jeder Brief endete mit den Worten „Amen, Alleluja“. Er lernte die einheimische Sprache und Kultur intensiv mit den Menschen dort, und er übersetzte das Neue Testament in Macau-Xirima, die Sprache der Menschen dort –
Ein Wirken im Stillen, in viel Trübnis, aber erfüllt vom Geist Jesu – nicht zur Ehre vor den Menschen, sondern als ein Same, der dort Frucht bringt, wo die Liebe Gottes ganz besonders gebraucht wird.
Im Islam schließlich gibt es ein kurzes, klares Bekenntnis. „Ich bekenne: Es gibt keinen Gott außer Gott. Muhammad ist der Gesandte Gottes.“ Wer es öffentlich vor Zeugen ausspricht, ist damit Muslim. »Islam« heißt »Hingabe an den Willen Gottes«, und »Muslim« ist der in den Willen Gottes Ergebene. Dem dient das ganze »theologische« Nachdenken im Islam, vor allem aber die Anleitung zu einer frommen und ethisch verantwortlichen Lebenspraxis in der großen, weltweiten muslimischen Gemeinde, der Umma. Die zentrale Quelle hierfür ist der Koran, das auf Mohammed herabgesandte, unverfälschte Wort Gottes. Es wird gültig interpretiert durch das Lebensbeispiel des Propheten Mohammed, aufbewahrt in den Hadithen, den Überlieferungen über sein Reden und Verhalten.
Für das Leben als frommer Muslim, für seinen Glauben wie für sein Verhalten, sind dabei die 5 Hautpflichten, man nennt sie auch die „5 Säulen“, maßgeblich: 1) das Bekenntnis, 2) das fünfmalige tägliche Gebet, 3) das Fasten im Monat Ramadan 4) das Almosen: eine Art Armensteuer, bei der wenigstens zweieinhalb Prozent der Einkünfte bzw. des Besitzes aller Vermögenden den Armen zugute kommen sollen, 5) die Wallfahrt nach Mekka, die alle, die Mittel und Zeit dazu aufbringen können, wenigstens einmal im Leben unternehmen sollen.
Ein besonderes Kennzeichen dieser religiösen Pflichten ist, dass es sich jeweils um öffentliche, gemeinschaftliche Bekenntnishandlungen handelt. Das Bewusstsein, dass sie für die gesamte weltweite Gemeinschaft der Muslime gelten und überall nach den gleichen Grundregeln durchgeführt werden, verleiht ein besonderes Gefühl der Verbundenheit miteinander in der Hinwendung zu Gott, aber auch einer solidarischen und sozialen Zusammengehörigkeit. Ihre Einfachheit und Klarheit wird als Geschenk der Barmherzigkeit Gottes verstanden.
Da der Islam in seiner Geschichte in vielen Ländern die Grundlage des Gesellschaftssystems gewesen ist, ist verständlich, dass es Muslimen in einer säkularen, pluralen Gesellschaft wie bei uns häufig nicht leicht ist, ihren Weg zwischen Tradition, herkömmlichen Lebensformen und einer modernen Interpretation des Koran und der Glaubensgrundsätze zu finden. Ein Hoffnungszeichen bei uns ist, dass es in Deutschland inzwischen an mehr als 10 Universitäten islamische Abteilungen gibt, mit Professorinnen und Professoren, die ich fast alle persönlich kenne und die durchweg ein offenes, dialogisches Verständnis des Islam vertreten.
Auch hier möchte ich von einer Freundin erzählen, die Wegbereiterin eines zeitgemäßen Islam und einer islamischen Religionspädagogik gewesen ist. Schon in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sie erste Lehrplanentwürfe für islamischen Religionsunterricht in Deutschland beraten. Beyza Bilgin war Professorin und stellvertretende Dekanin an der Theologischen Fakultät der Universität Ankara. Sie hat ihre Doktorarbeit über das Thema „Die Prinzip der Liebe als Grundlage der Erziehung im Islam“ geschrieben. Beyza Bilgin – sie ist leider im vergangenen Jahr verstorben – war der Überzeugung, dass die Liebe notwendig zum Glauben gehört, und dass, wer von der Liebe Gottes weiß, darum auch die anderen Menschen lieben wird. Das betrifft zentral den Umgang mit Kindern: Ihnen zugewandt sein, ihnen zu vermitteln, dass sie angenommen und geliebt sind, ihre Fragen ernst nehmen und mit ihnen Lernende zu sein, das war für sie nicht nur die Leitidee der religiösen Erziehung, sondern geübte Praxis. Über viele Jahre war sie in der Türkei eine beliebte Erzählerin im Rundfunk: „Beyza teyzeden hikajeler“ hieß die Sendereihe – „Geschichten von Tante Beyza“! 7 Mal war sie bei unseren Nürnberger Foren zur Kulturbegegnung. Sie hat für ihre Arbeit als Brückenbauerin zwischen Christentum und Islam das Bundesverdienstkreuz erhalten und vom türkischen Journalistenverband einen Preis als die „Frau mit dem mutigen Herzen“.
Damit schließe ich meinen kurzen Weg durch die Religionen. Auch wenn es nur der Becher ist, der etwas von dem Ozean der Religionen schmecken lässt, werden Sie wie auch ich einen Eindruck davon haben, dass es weltweit eine Gemeinde von Menschen guten Willens gibt, die auf der Basis ihres Glaubens und Bekennens Sonnenstrahlen in eine oft so zerrissene, bedrängende und von Not und Ängsten umgebene Gegenwart senden.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, erfülle unsere Herzen und Sinne jetzt und zu aller Zeit. Amen.
—
Prof. em. Dr. Johannes Lähnemann, Goslar, johannes.laehnemann@gmail.com
Johannes Lähnemann (geb. 1941) hatte von 1981-2007 den Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Ev. Religionsunterrichts an der Universität Erlangen-Nürnberg inne. Er lebt im Ruhestand in Goslar. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Interreligiöser Dialog, Interreligiöses Lernen, Religionen und Friedenserziehung. Er ist Mitglied der internationalen Kommission Interreligious Education der Bewegung Religions for Peace (RfP) und Leiter der Arbeitsgruppe Interreligiöse Bildung-Friedenspädagogik bei Religionen für den Frieden Deutschland.
Seine Autobiografie ist erschienen unter dem Titel „Lernen in der Begegnung. Ein Leben auf dem Weg zur Interreligiosität.“ Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2017.
Die Predigt wird in der Marktkirche, der zentralen (gotischen) Kirche in Goslar, gehalten.
Liedempfehlungen: EG 450: Morgenglanz der Ewigkeit; EG 607: Vertrauen wagen; EG 612: Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen! Kanon EG 172: Sende dein Licht und deine Wahrheit
—
[1] M. Weingardt: RELIGION MACHT FRIEDEN: Stuttgart 2007.
[2] buddhismus-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/03/
[3] D. Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Tb.-Ausgabe. München 1964, S. 74
