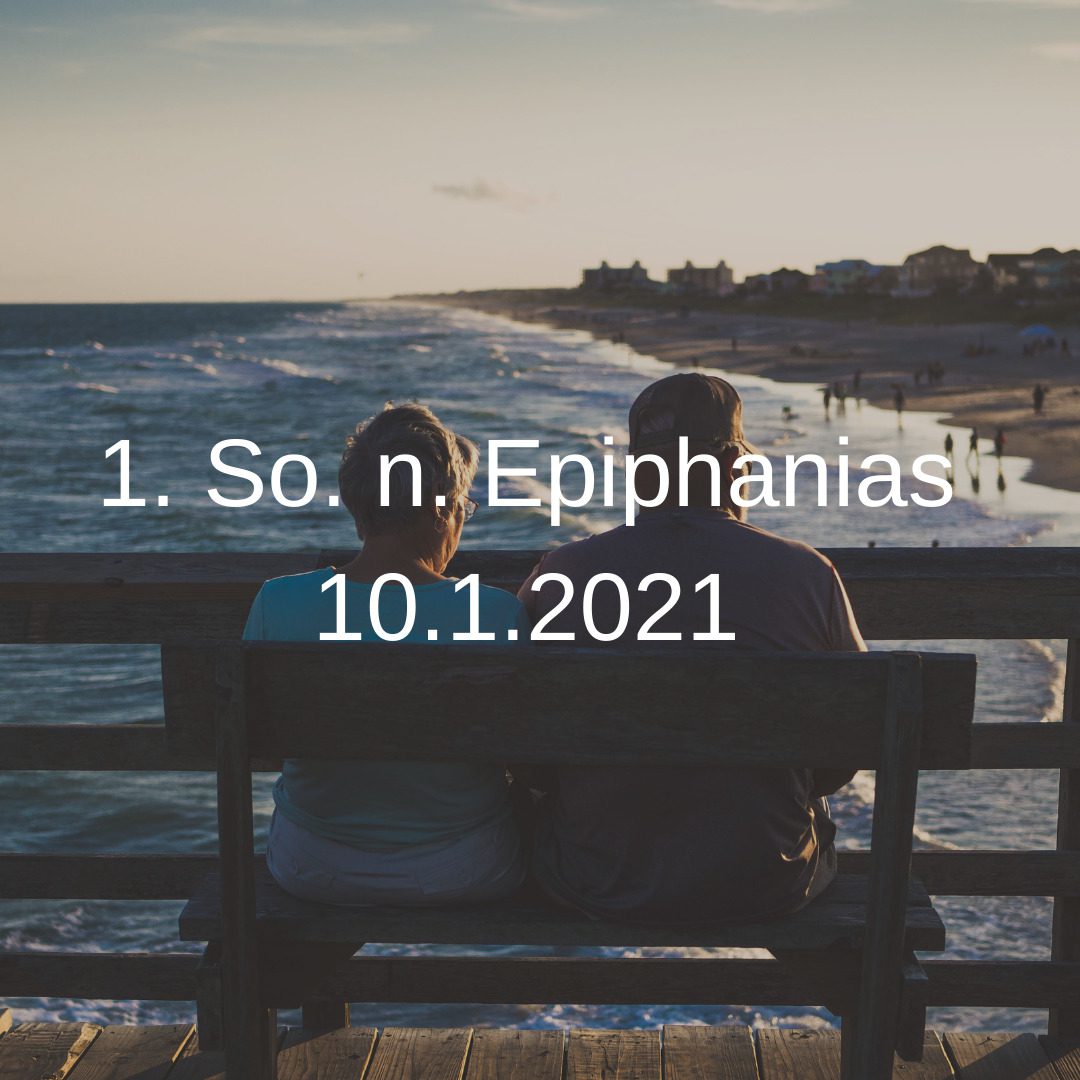
Gott ist dort, wo Menschen …
Gott ist dort, wo Menschen nachdenken und sich wundern | Erster Sonntag nach Epiphanias | Lukas 2,41-52 (dänische Perikopenordnung) | Margrethe Dahlerup Koch |
 Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Es gibt unzählige Darstellungen dieser Szene. In diesem Jahr aber sah ich eine Variante der Geburtsszene, die ich noch nie gesehen hatte. Das ist ein Bild, das aus einem französischen Gebetbuch aus dem 15. Jahrhundert stammt. Im Vordergrund sieht man den alten Vater Josef mit dem in Windeln gewickelten Kind in den Armen. Er sieht konzentriert auf das kleine Kind. Im Bett sitzt Maria mit einem Buch, auf das sie sich mindestens genauso sehr konzentriert und in das sie sich vertieft. In einer Einzäunung hinter ihnen stehen ein Esel, der sich über Josef beugt, und eine Kuh, die auf die lesende Maria blickt.
Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Es gibt unzählige Darstellungen dieser Szene. In diesem Jahr aber sah ich eine Variante der Geburtsszene, die ich noch nie gesehen hatte. Das ist ein Bild, das aus einem französischen Gebetbuch aus dem 15. Jahrhundert stammt. Im Vordergrund sieht man den alten Vater Josef mit dem in Windeln gewickelten Kind in den Armen. Er sieht konzentriert auf das kleine Kind. Im Bett sitzt Maria mit einem Buch, auf das sie sich mindestens genauso sehr konzentriert und in das sie sich vertieft. In einer Einzäunung hinter ihnen stehen ein Esel, der sich über Josef beugt, und eine Kuh, die auf die lesende Maria blickt.
Was stellt dieses Bild dar? Eine zerstreute Mutter, die lieber lesen will als Kinder hüten? Ein fürsorglicher Vater, der Windeln wechseln kann? Ja, das würden viele vielleicht gerne in diesem Bild sehen, aber wenn man die Zeit, das 15. Jahrhundert, in Betracht zieht, dann glaube ich, dass das Bild von etwas anderem handelt. Es illustriert einen ganz bestimmten Satz im Weihnachtsevangelium. Die Hirten ziehen nach Bethlehem, finden das Kind, Josef und Maria, und sie erzählen ihnen, was der Engel ihnen von dem neugeborenen Kind verkündet hat, nämlich dass er Christus ist. Und dann kommt der Satz, den der Künstler aus dem 15. Jahrhundert dargestellt h at: „Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen“.
Und der Maler hat also dies dargestellt, indem er sie sitzen und lesen lässt. Herz und Hirn als Gegensätze und die Aussage, dass da etwas ist, in der Regel das Wichtigste, das man sich nicht anlesen kann -von all dem weiß der Maler nichts. Im Gegenteil. Über die Worte nachzudenken und versuchen herauszufinden, was das bedeutet, dass der Neugeborene eine große Freude für das ganze Volk und ein Heiland ist, das kann man sich offenbar nicht anlesen.
Und deshalb sollen wir nun an diesem ersten Sonntag nach dem Ende des Weihnachtsfestes mit in den Tempel. Hin zu den Gelehrten. Dorthin, wo die alten Schriften noch in Erinnerung sind, studiert und erforscht werden. Dort wo der Kleine, der nun den Windeln entwachsen ist, sich als ein eifriger, neugieriger und schlagfertiger zwölfjähriger Junge erweist. Klug ist er. So klug, dass er den Lehrern zuhört und ihnen Fragen stellt. Wohl um selbst klüger zu werden. Wohl weil er, wie seine nachdenkliche Mutter, weiß, dass man aus Worten und Wissen anderer klug werden kann. Das Alte ist nicht nur Quatsch und etwas, was veraltet ist. Die Alten sind nicht hoffnungslos veraltet. Der Evangelist Lukas schildet die n Alten – anders als manche unserer Liederdichter – mit großem Respekt als Lehrer des Tempels. Denn sie hören ihrerseits auch auf den zwölfjährigen Jesus. „Alle wunderten sich über seine Einsicht und die Antworten, die er gab“, steht da. Das ist beschrieben, als ob sie sozusagen sehr gut miteinander auskommen und sich bereichert fühlen, der Junge und die weisen alten Männer. Eine Gemeinschaft über die Generationen hinweg.
Und darin liegt in sich eine erbauliche Pointe. Den hochmütigen Aberglauben, dass wir von Generation zu Generation immer klüger werden, kann man nur festhalten, wenn man dumm und geschichtslos ist. Die Altes wussten etwas, was wir vergessen haben. Man kann ja nur im letzten Monat sich damit versucht haben, Plätzchen zu backen, um das zu erfahren. Und umgekehrt wissen wir etwas, von dem die Alten nichts geahnt haben. Aber die Summe an Wissen und Begabung ist wohl durch die Generationen der Menschheit konstant geblieben.
Da liegt aber in der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus im Tempel mehr als das. Denn es sind ja nicht nur die Lehrer, die klugen alten Juden, mit denen Jesus reden will. Er ist im Tempel, weil „ich bei meinem Vater sein muss“, sagt er zu Maria, als sie ihn am dritten Tag wiederfindet. Und diese Worte bewegt sie nun in ihrem Herzen, dort wo die Worte der Engel aus der Weihnacht schon liegen.
Die Stätte der Gelehrsamkeit als Elternhaus. Gott als der, der dort ist, wo Menschen nachdenken, sich wundern, miteinander reden und dadurch klüger werden. Das ist so gesehen ein kleines Bild einer Gemeinde und eines Gottesdienstes. Ein Bild für uns von dem, was ein guter Gottesdienst ist: Gott begegnet uns. Nachdenken, sich wundern, Gespräche, Aufklärung.
So ist ein guter sonntäglicher Gottesdienst. Nachdenklich, wundernd, gesprächsbereit und aufklärend in der Begegnung.
Und deshalb feiern wir Gottesdienst. Um so Gott und einander zu begegnen. Und fällt es einem hin und wieder schwer, Lust zu verspüren, an einem Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen, dann sei dies die Begründung: Man soll nicht in die Kirche gehen aus Rücksicht auf sich selbst, sondern für die anderen. Die, die sonst niemand hätten, mit denen sie Gottesdienst feiern können.
Denn das Wort des Zwölfjährigen, dass er bei seinem Vater sein sollte, gilt nicht nur für ihn selbst. Das gilt auch für alle seine Geschwister: Wir sollten bei unserem Vater sein. Und das hat seit der Weihnacht, als dieser Vater beschloss, Mensch zu werden, bedeutet, dass unser Platz hier in der Welt ist, wo er uns selbst antreffen will. Auf der Kirchenbank und auf der Bank unten bei Aldi, am Tisch des Herrn und am Sofatisch in der Wohnung oder im Pflegeheim, am Taufbecken und dort, wo der irritierende Kollege und unfähige Vorgesetzte sich als die Klügsten erwiesen.
Denn es war Weihnachten. Gott wurde Mensch. Und deshalb ist Gott nun im Menschlichen zu finden.
Deshalb liegt die Kirche hier mitten im Ort. In ihrer ganzen Besonderheit mitten im Gewöhnlichen. Und hier werden wir stets daran erinnert: das Göttliche ist im Menschlichen zu finden.
Wenn unsere jungen Leute, etwas älter als der zwölfjährige Jesus, den Stuhl verlassen, der neben der Bank mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern steht, all das, was heimisch ist und bekannt – und dann hinaufgehen zum Altar, niederknieen und noch einmal Kinder Gottes genannt werden – dann gehen sie, die gerade als göttlich bezeichnet wurden, wieder an ihren Platz, den Platz in der Welt, in der Familie, in der Gesellschaft.
Oder wenn wir hier draußen auf dem Kirchplatz stehen, und der Sarg in den Leichenwagen gestellt ist. Die Worte sind gerade erklungen, dass wir und der Tote wieder zu der Erde werden, aus der wir genommen sind, weil wir aus der Erde wieder auferstehen. Wir sind all zusammen gerade dazu bestimmt, Erben des Himmelreichs zu sein. Und dann erklingt eine ferienfrohe Kinderstimme vom Markt her: „Mama, kuck mal“, und ein Fahrradfahrer fährt um die Ecke auf dem Weg zur Sparkasse. Wir entdecken plötzlich, wo wir sind, und das ist ein ganz gewöhnlicher Alltag.
Oder wir kommen sonntags aus der Kirche nach Hause. Wir checken der Benzinpreis wie gewöhnlich, oder wir holen uns eben ein Brot beim Bäcker. Wir tun ganz gewöhnliche Dinge, obwohl wir gerade gehört, gesehen und geschmeckt haben, dass wir Kinder Gottes und Miterben Christi sind. Wir kehren zurück in unser Dorf, unseren Wohnort, in unser Nazareth, und wir wissen zugleich, dass das auch ein Ort Gottes ist.
Wir haben Worte bekommen, die wir in uns bewegen. Worte, die wir uns vornehmen können, über die wir uns wundern können, über die wir miteinander reden können, bis wir von hier gehen und die Welt der anderen nicht mehr unsere Welt ist und die Zeit ohne uns weitergeht. Und Gott selbst muss das Wort in den Mund nehmen und es uns wieder am dritten Tag sagen: Du bist noch immer da, wo du sein sollst, hier bei mir, deinem Vater und deinem Gott. Amen.
Pröpstin Margrethe Dahlerup Koch
Fjord Alle 13
DK-6950 Ringkøbing
E-mail: mdk(a)km.dk
Bildnachweis: public domain
